Der folgende Aufsatz von Lyndon H. LaRouche jr. erschien in dem Magazin So denken wie Beethoven, Wiesbaden, Campaigner Publications, 1978.
Überall, wo sich die moderne europäische Kultur ausgebreitet hat, gilt es mit Ausnahme unterprivilegierter Kreise – zu Recht – als unumstößliche Tatsache, daß das Beethovensche Werk ein Bergmassiv ist, neben dem Monteverdi, Bach, Mozart, Schumann und Brahms nur als die ansteigenden bzw. abfallenden Ausläufer erscheinen.
Tausende Male haben von Hochachtung erfüllte Musiker versucht, die Spitze zu erreichen, und sind kurz vor dem Gipfel zurückgewichen. Tausende Male hat man mit gemeiner, boshafter Mißgunst versucht, die Spitze abzuschlagen und seinen Ausläufern an Höhe gleichzumachen. Schlechte Aufführungen, übelwollende Musikgelehrtheit und schließlich das ohrenbetäubende Getöse frenetischer, modernistischer Kakophonie haben versucht, den großen Gipfel aus Auge und Ohr der Allgemeinheit zu vertreiben. Doch allein eine halbwegs vernünftige Aufführung einiger Beethoven-Kompositionen beweist uns voll und ganz, daß der Gipfel alles überragt – unerreicht wie je zuvor.
Für den Menschen gibt es keine unerreichbaren Höhen, da alles Bestehende der gesetzmäßigen Ordnung des Universums unterworfen ist. Es gibt immer eine Methode und einen Weg, der rasch und sicher auf den Gipfel eines jeden Bergmassivs führt. Die Möglichkeiten dazu sind im wesentlichen eine Frage von Technologie und Wissen. Was wir zu tun in der Lage sind, ist durch den Fortschritt unserer Technologie begrenzt; ob wir erfolgreich erlangen können, was die verfügbare Technologie in sich birgt, hängt davon ab, ob wir den richtigen Weg wissen und die nötige Entschlossenheit aufbringen, die eingeschlagene Richtung weiterzuverfolgen.
Von dieser Voraussetzung aus können wir menschliche Kolonien auf dem Mars als eine Aufgabe zu Anfang der 90er Jahre ansehen. Aus dem gleichen Grund ist die Meisterung Beethovens eine Aufgabe, die wir eigentlich noch davor erreichen sollten. Beethoven ging aus der gleichen europäischen Kultur hervor, die die Amerikanische Revolution hervorbrachte und die Vereinigten Staaten begründete.
Obwohl große Musiker und Dirigenten mit ihren Aufführungen der Beethovenschen Kompositionen den darin enthaltenen Absichten sehr nahe gekommen sind, hat doch keiner bisher das musikalische Wissen so gemeistert, daß er in der Produktion an die Qualität dieser Kompositionen heranreichen könnte. Mögen alle Musiktheoretiker so lautstark auf dieser oder jener Erklärung der Beethovenschen Kompositionsmethode beharren wie sie wollen, bisher können sie nur kindische Parodien auf Beethovens scheinbare Eigenarten vollbringen; sie konnten kein Werk komponieren, aus welchem ein genügendes Verständnis der wirklichen Gesetze ersichtlich ist, die Beethoven selbst anwandte.
Es ist an der Zeit, diesen frustrierenden Zustand aus der Welt zu schaffen. Wenn auch das, was wir zu sagen haben, noch nicht die notwendige musikalische Ausarbeitung des erforderlichen Konzepts ist, so ist es doch der Schlüssel zu der Tür, durch welche derartige musikalische Forschung hindurch muß. Im Raum hinter dieser Tür wartet die vollständige Lösung für dieses Problem darauf, begriffen zu werden.
Der Weg zu dem hier bereitgelegten Schlüssel schließt zwei Hintergrundbetrachtungen ein. Der erste dieser Aspekte der Herangehensweise ist die Tatsache, daß große Musiker Beethovens Werke gewöhnlich zwar hinreichend interpretieren können, daß ihnen aber gleichzeitig offenkundig der zielgerichtete willentliche Anstoß fehlt, um eine vergleichbare kompositorische Qualität selbst zu wiederholen. Der in den umfassenderen Implikationen des ersten liegende zweite Punkt ist die besondere persönliche Beziehung des Autors zur Beethovenschen Musik.

Mit dem ersten Punkt fegen wir als epistemologisch inkompetent, als wilde spekulative Metaphysik, die Vorstellung vom Tisch, daß in Beethoven so etwas wie ein außerirdischer „Intuitionsfunke“ schlummerte. Es gibt keine übernatürliche Eigenschaft in dem, was man die charakteristischen Merkmale eines Genies nennt.
In den Naturwissenschaften läßt sich Genius festmachen in der Unterscheidung zwischen dem Praktiker, der sich ein bestimmtes Wissensgebäude zueigen gemacht hat, und dem Wissenschaftler, der die Geisteskräfte ausgebildet hat, neue, fruchtbare Elemente wissenschaftlicher Erkenntnis hervorzubringen. Beim durchschnittlichen Wissenschaftler reichen schöpferische Fähigkeiten bis zu Erkenntnissen, die notwendige Ergänzungen und Verbesserungen in einem bestehenden, unmittelbar geschlossenen Bereich wissenschaftlicher Konzeptionen und methodologischer Grundsätze bewirken können. Der schöpferische Wissenschaftler schafft Kategorien neuer Konzeptionen und verändert damit die Gesamtheit wissenschaftlicher Erkenntnis in einschneidender, revolutionärer Weise.
Die hohe Qualität schöpferischer wissenschaftlicher Arbeit ist keine Abfolge von Zufällen. Sie ist vielmehr das Ergebnis davon, die wissenschaftliche Anschauung im allgemeinen auf ein höheres – „transfinites“ – Niveau zu heben: Die Methode der wissenschaftlichen Anschauung auf das empirische Praxiswissen anzuwenden, das sich aus der gesetzmäßigen Ordnung erfolgreicher Grundlagenhypothesen ergibt. Dies ist, was man unter Erkenntnistheorie versteht.
Die Tatsache, daß der gewöhnliche wissenschaftliche Verstand große wissenschaftliche Entdeckungen als wundersame Erscheinungen auffaßt oder, was auf das gleiche hinausläuft, sie als rein logische Entwicklung innerhalb des bestehenden Wissensgebäudes wegerklärt – reflektiert lediglich die Tatsache, daß dem normalen wissenschaftlichen Arbeiter seine eigenen wichtigen Entdeckungen als etwas „unterlaufen“, was – von seinem verfehlten Standpunkt aus – unerklärlich ist. Ihm sind die gesetzmäßigen Prinzipien unbekannt, die die aufsteigende Ordnung grundlegender Hypothesen bestimmen.
Wenn man die Implikationen dieses erwiesenen erkenntnistheoretischen Faktums wissenschaftlichen Fortschritts der Untersuchung von Kreativität in der Musik – und anderen wichtigen Kunstformen – zugrundelegt, folgt daraus der richtige Ansatz zum Verständnis der streng gesetzmäßigen Prinzipien in Beethovens Kompositionsprozeß. Wenn man das als ersten untergeordneten Punkt angesprochene Problem in diesem Licht betrachtet, löst sich das scheinbare Paradox ebenso auf. Die empirische Evidenz der Beethovenschen Musik bestätigt die auf diese Weise erreichten Lösungen direkt und umfassend.
Für den großen Musiker oder Dirigenten sind die Ergebnisse von Beethovens kompositorischem Prozeß ein feststehendes Faktum musikwissenschaftlicher Erkenntnis. Der Musiker oder Dirigent erlangt entsprechende Einsicht in ein besonderes Werk Beethovens am unmittelbarsten, indem er nicht nur Beethovens Kompositionen insgesamt betrachtet, sondern auch die Beziehung zwischen diesen Werken als gesetzmäßigen Prozeß der musikalischen Entwicklung Beethovens nimmt. Von daher ist es wichtig, auf das Datum einer Beethoven-Komposition zu achten und in Beethovens Skizzenbüchern zu forschen. Der Musiker sieht richtigerweise Beethoven auch – und vor allem – im Zusammenhang mit Bach, Mozart und gleichlaufenden italienischen Einflüssen, die sich in verschiedener Art und Weise bemerkbar machen, in der Weise, wie Beethoven sie aufgreift und bewußt als einschränkend verwirft. Genau weil der große Meister oder Dirigent sich in das musikalische Umfeld Beethovens eingearbeitet hat, ist er dazu befähigt, Konzepte nachzuvollziehen, die mehr oder weniger genau sowohl die allgemeine Qualität Beethovens wie den besonderen Wert eines Einzelwerkes und darin enthaltener kohärenter Teile ausmachen.
Diese Konzeption der Komposition besteht im Geist des Musikers oder Dirigenten als eine Gestalt, ein befruchtender Begriff der Komposition als kohärenter Entwicklungsprozeß. Die Aufführung des Musikers, geleitet von diesem erzeugenden Begriff der Komposition, die er zum eigenen kenntnisreichen wissentlichen Antrieb gemacht hat, soll die empirische Praxis der Aufführung in ungefähre Übereinstimmung mit den Erfordernissen des erzeugenden Begriffs bringen. Er hat das Wesen der Komposition im Geiste gehört. Er hat sich auf diese Weise mit dem inneren Ohr seines geschulten Geistes angeeignet, was geschaffen wurde. Er kann somit eine prachtvolle Interpretation liefern – vorausgesetzt, er hat hierfür die praktischen musikalischen Fertigkeiten entwickelt – selbst wenn er nicht die zusätzlichen notwendigen Qualifikationen besitzt, um selbst solche Musik zu schaffen.
Eine äußerst wichtige Parallele zu diesem Faktum ist, daß die Unfähigkeit praktisch aller wichtiger Musikologen und Musiktheoretiker bis heute ist, daß sie das Problem, den befruchtenden kompositorischen Prozeß zu entdecken und zu erklären versuchen, vom formalisierten Standpunkt des vollendeten Virtuosen oder Dirigenten in Angriff nehmen. Sie haben sich damit dickköpfig auf die entgegengesetzte Seite des Ortes gestellt, wo der Gegenstand ihrer Suche zu finden ist. Sie nehmen den Gedanken einer Beethoven-Komposition nur vorbewußt wahr; sie kennen nicht den höheren Begriff willentlicher Erzeugung solcher einzelner Gedanken.
Das Problem ist kein musikalisches Problem per se. Die Lösung des Problems muß empirisch im Bereich der Musik gezeigt werden, da – wie wir sicher wissen – Beethovens wesentliche Qualität in der Erkenntnistheorie liegt; er entwickelte seine eigene epistemologische Weltanschauung, indem er Musik als streng gesetzmäßigen Bereich menschlicher Praxis behandelte. Anders gesagt, will man den Schlüssel zu Beethovens Kreativität entdecken, muß man ihn als einen der größten schöpferischen wissenschaftlichen Denker in der Geschichte begreifen, dessen Kompositionen als Ausdruck seines musikalischen Selbstentwicklungsprozesses die Prädikate eines Prozesses grundlegender, epistemologisch geordneter Entdeckungen sind.
Der Hintergrund für die Lösung
Aus zwei miteinander zusammenhängenden Gründen ist der Verfasser in der vorteilhaften Situation, diesen Aspekt des Problems zu lösen. Erstens, weil er Musik – mit besonderer Betonung der Beethovenschen Musik – sehr frühzeitig als höchst übereinstimmend mit und förderlich für seine Selbstentwicklung entdeckte. Zweitens, weil der Verfasser während seines ganzen Lebens einen Weg intellektueller Selbstentwicklung verfolgt hat, der ihn während der vergangenen zwei Jahrzehnte in die vorderste Reihe der intellektuell einflußreichen Kreise gebracht hat, die zu einem grundlegenden erkenntnistheoretischen Durchbruch in unserem Verständnis der Natur und Implikationen dessen, was wir Wissenschaft nennen, beigetragen haben.

LaRouche: „Will man den Schlüssel zu Beethovens Kreativität entdecken, muß man ihn als einen der größten schöpferischen wissenschaftlichen Denker in der Geschichte begreifen.“
Die gegenseitige Verbindung zwischen diesen beiden Elementen im Verfasser befähigt und verpflichtet ihn, Beethoven vor Beethovens hinterhältigen Feinden und fehlgeleiteten Bewunderern von heute zu verteidigen. Dies nicht so sehr, um die Bedeutung von Beethovens Musik zu verteidigen, sondern die Identität Beethovens, selbst des lebenden Beethoven, der Musik schuf.
Obgleich sich der Autor seit einigen Jahren grundsätzlich über die Lösung für das Problem der Beethovenschen Kreativität bewußt war und er Musiker zu motivieren versuchte, geeignete musikalische Forschungsrichtungen weiterzuverfolgen, hatte er bis jetzt seine öffentlichen lnterventionen in die Sache selbst auf knappe Provokationen beschränkt, um damit frische Energie und breiteres Engagement in der musikalischen Forschung als solcher zu stimulieren. Vor kurzem haben sich die Umstände jedoch qualitativ entscheidend verändert, so daß er sich jetzt zu öffentlichem Eingreifen qualifiziert und verpflichtet fühlt, um die Lösung in der hier erreichten Weise noch gründlicher und positiv zu definieren.
Eine Zusammenfassung wichtiger autobiographischer Fakten hilft dem Leser, die Art und Weise zu verstehen. wie diese Lösung hier dargestellt ist.
Der Verfasser, der sich den größten Teil seines Erwachsenendaseins der schöpferischen Arbeit gewidmet hat, sah sich beständig bleibenden begrifflichen Problemen gegenüber wie jeder, der ähnlich engagiert ist. Die zusammenhanglosen Mißtöne, die das tägliche Leben begleiten, sind der besonderen Qualität von Konzentration, wie sie erfolgreiche schöpferische Arbeit verlangt, fremd und abträglich. Jeder, der sich regelmäßig schöpferischer Arbeit hingibt, entwickelt daher Wege – die einige dieser Personen als eine Art Trickkiste bezeichnen – um während der Zeit konzentrierter Anspannung eine Art psychologische Mauer um sich herum aufzubauen. Zu Beginn solcher Phasen haben diese „Tricks“ die zielgerichtete Funktion, die Mißtöne aus dem Kopf zu vertreiben: als sinnliches Hilfsmittel (Kathexis), durch das sich der Geist in die Lage versetzt, sich auf eine bestimmte innere Stimmung zu konzentrieren und den inneren Widerhall des Mißklanges auszublenden.
Der Verfasser hat sich zu diesem Zweck eine bestimmte Reihe solcher „Tricks“ zur Gewohnheit gemacht. Diese „Tricks“ haben kein zufälliges Wesen; sie haben nicht die fetischistische Besetzung jener „Krücken“, die zugegebenermaßen von vielen anderen zum gleichen Zweck eingesetzt werden. Jene, die der Verfasser benutzt, sind von zweierlei Art und lassen sich als positive und negative unterscheiden.
Die positiven Hilfsmittel haben das gemeinsame Merkmal, daß sie eine direkte intellektuelle Beziehung herstellen, schöpferisches Denken über das Medium der Literatur oder der Musik anregen. Als Nebenprodukt lernt man so das innere Selbst von Persönlichkeiten über große Entfernungen von Zeit und Raum hinweg kennen. Mit Geschichtskenntnissen über die Zeit großer Schriftsteller und Künstler lernt man in der Tat die großen Persönlichkeiten genauer und enger kennen als die Menschen nebenan oder oft genug die eigenen Familienmitglieder.
Die negative Form nützlicher Umgebung ist ein Stück, ein Kunstwerk usw., welches die Wut auf das Böse oder die Dummheit wendet (was moralisch gesehen oft das gleiche ist), auf die man dort gestoßen ist.
Die Art und Weise, wie der Verfasser geistig auf diese verschiedenen „psychologischen Umfelder“ zur Konzentration reagiert, ist nicht in allen Fällen gleich homogen. Es sind Beethovens herausragende Kompositionen, die in bestimmter Weise in genauer Übereinstimmung mit dem geistigen Leben des Verfassers stehen und die empirisch nachweisbar den ergiebigsten Aspekt seiner eigenen Kreativität erwecken.
Dem entspricht durchaus, daß sich die persönlichen Beziehungen des Verfassers teilweise durch Beethovens Einfluß auf diese Personen bestimmen. Dabei geht es nicht um den gleichen persönlichen Geschmack – eine solche „Erklärung“ wäre nichts als die geschmackloseste Dummheit; so einfach geht es nicht. Die Reaktion hängt nicht davon ab, daß man weiß, ob der andere eine solche „Vorliebe“ hat oder nicht, sondern vielmehr davon, daß entsprechende Persönlichkeiten sich als Individuen erweisen, die besonders veranlagt sind, auf Beethoven auf bestimmte Art und Weise zu reagieren, ob sie nun früher eine solche Vorliebe entwickelt haben oder nicht.
Umgekehrt ist nicht jeder, der meint, ein „Beethoven-Verehrer“ zu sein, auch ein sympathischer Mensch – gelegentlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Es ist der schöpferische Aspekt in Beethoven, der hier entscheidend ist.
Ein weiteres Element dieser Beziehung zu Beethoven hat für den vorliegenden Punkt große Bedeutung.
Wenn auch die Wurzeln der Sache noch weiter zurückliegen, war es eine 1952 durch das Studium Georg Cantors ausgelöste innere Revolution, die den Verfasser auf einen Weg zielgerichteter schöpferischer Bemühungen brachte, auf den dann folgenden Weg gezielter Selbstentwicklung, der bis zum heutigen Zeitpunkt führte. Seit dieser Zeit war die Lebensweise des Verfassers von Phasen sich über Tage erstreckender konzentrierter Anspannung auf die Durcharbeitung einer ursprünglichen Einsicht in eine fertig oder halbfertig ausgearbeitete – zunehmend in schriftlicher Form – gekennzeichnet. In diesem Prozeß spielte Beethoven eine integrale Rolle, in dem Sinne, daß der an dieser Stelle betrachtete Aspekt Beethovens ohne jeden Zweifel den mächtigsten und charakteristischsten intellektuellen Einfluß auf die Herausbildung der heutigen entwickelten Anschauung des Verfassers ausübte.
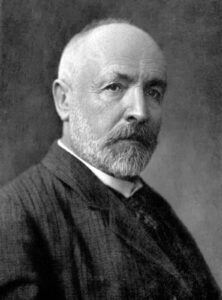
Dies trat in der einzigen Art und Weise auf, wie eine solche Entwicklung gesetzmäßig auftreten kann. Innerhalb dieses Prozesses steht die Weise, wie Georg Cantors Werk die innere Revolution zu einer sich selbst erneuernden, gezielten Bewegung auslöste, in entscheidendem Zusammenhang zu dem Prozeß, wie wir noch sehen werden.
Mit den Jahren wurde Beethoven für die Projekte des Verfassers immer bedeutsamer.
Immer wenn störende Einflüsse den kreativen Prozeß zu Beginn oder inmitten der Konzentration für einen Augenblick „auszuschalten“ drohten, erwies sich das Hören von Beethovens Musik oder das Durchblättern einer oder mehrerer seiner Werke auf der Suche nach tieferer Erkenntnis des „Warums“ ihrer Entwicklung als das wirksamste Mittel zur Wiedererlangung der notwendigen Klarheit und Konzentrationsfähigkeit.
Die Vollendung eines besonders befriedigenden Projektes erforderte Musik in großen Mengen – später Mozart, einige Aspekte von Bach, Schumann, Schubert, Hugo Wolf, Brahms, doch all dies war nur eine Verheißung, ein nützlicher Gegensatz zu dem, was einzigartig in Beethoven existierte. Die Vollendung eines wichtigen kreativen Unterfangens, besonders dann, wenn man von ihm über einen Zeitraum von Tagen oder länger völlig eingenommen wird, erfordert eine Art sozialisierte „Entfaltung“, die moralisch mit jenen Aspekten des eigenen Wesens übereinstimmen muß, welche das schöpferische Bemühen bestimmt haben.
Innerhalb dieses Prozesses war es die innere Gestalt Beethovens, das in den Entwicklungszügen seiner Musik ausgedrückte Ordnungsprinzip, und nicht so sehr die Musik als solche, dessen sich das Verlangen des Verfassers bemächtigte als „etwas Soziales, das meinen Sinn für den Wert der Menschheit, der von der vorausgegangenen Arbeit in mir mitschwingt, widerhallen läßt.“ Je weiter sich die moralische Übereinstimmung des Verfassers mit Beethoven vertiefte, desto häufiger ergaben sich neue und tiefere Einsichten in Beethoven, und dieser Prozeß trat vor allem immer unmittelbar nach einer längeren schöpferischen Anstrengung ein.
Der Verfasser hat soeben seine Arbeit Der Fall Walter Lippmann((Lyndon H. LaRouche jr., The Case of Walter Lippmann. Campaigner Publications. 1977)) fertiggestellt, vielleicht das weitaus wichtigste Werk, das er bisher in Angriff genommen hat. Dies war ein Projekt, das – als Analyse der sogenannten „Amerikanischen Ideologie“ – in verschiedenen andiskutierten Vorstadien seit Ende der 60er Jahre und als „Lippmann-Projekt“ seit Spätherbst 1975 der Vollendung harrte. Es war also wie alle wirklich wichtigen Arbeiten, eine von Anbeginn an gründlich durchdachte Anstrengung, deren Ergebnis unter der Kontrolle eines neu schaffenden Konzeptes und Zweckes entwickelt wurde, eines Konzeptes, welches Inhalt und literarische Darstellung von Anfang an leitete.
Wie bei allen solchen Projekten ist die Ausarbeitung des ursprünglichen Konzeptes in die Form einer folgerichtigen Entwicklung, die Begriffsbildung für den Leser, die intensivste Art anhaltender, selbstbewußter geistiger Aktivität, die ein Mensch erleben kann. Genau dies geschieht tatsächlich in Beethovens Musik. Diese Konzentrationsphase begann am 30. März und dauerte bis zum 16. April und nahm in dieser Zeit jeden Augenblick im Wachsein und Schlaf des Verfassers in Anspruch – ausgenommen von durchschnittlich drei Stunden pro Tag, die der Entwicklung der weltstrategischen Situation gewidmet waren. Das war der Rahmen für den energischen Entschluß, das Problem des Schlußsatzes von Beethovens 9. Sinfonie ein für allemal zu klären.
Dazu wiederum trug ein besonderer Faktor bei. Der Fall Walter Lippmann wurde mit der gewohnten Vorbereitung des Konzentrationsaufbaus, mit der Konzentration auf Beethoven begonnen. In diesem besonderen Fall stand das Problem Beethoven im Rahmen des teils fruchtbaren, teils bestürzenden Geschehens bei den Beethoven-Feierlichkeiten in Berlin (DDR) – über die der Verfasser in Zusammenarbeit mit Anno Hellenbroich einen Artikel geschrieben hatte (siehe Neue Solidarität Nr. 12/1977). Der vom Verfasser zu diesem Hellenbroich-LaRouche-Artikel beigetragene Mittelteil formulierte das Problem noch einmal in klarster Form, doch notwendigerweise, da die beschriebene musikwissenschaftliche Lösung darin fehlte, umschrieb er vielmehr die Aufgaben der weiteren Arbeit als das entscheidende musikwissenschaftliche Problem, wie bezeichnet, endgültig zu lösen.
Aufgrund der bohrenden erkenntnistheoretischen Identität wesentlicher Züge in Der Fall Walter Lippmann mit dem Problem Beethoven erwies es sich beim Schreiben des „Lippmann“-Werkes wiederholt als notwendig, das Problem Beethoven vorläufig beiseite zu schieben, ebenso wie oftmals ähnliche redaktionelle Urteile über andere fruchtbare Assoziationen, die nicht unmittelbar auf den Gesamtzweck des Werkes gerichtet waren, gefällt werden mußten. Auch dieses Problem ist charakteristisch für Beethovens Arbeit.
Daher die anschließende entfesselte Gewalt der Konzentration auf den schwierigen Schlußsatz der Neunten Sinfonie.
Beethovens Neunte
Anderthalb Tage lang ging der Verfasser wieder und wieder intensiv die Neunte durch und suchte unnachgiebig nach dem Geheimnis, das er dort verborgen wußte – mit Erfolg. Der Verfasser berichtete Anno Hellenbroich seine Ergebnisse und forderte ihn auf, diese Hypothese mit der Behandlung der Neunten bei Heinrich Schenker zu vergleichen. Hellenbroichs Arbeit wird eine Spannung zwischen der These des Verfassers und der Schenkers herstellen, die dann der Koordinierung des musikwissenschaftlichen Aspekts weiterer Arbeiten als Bezugsmaßstab dienen kann. Damit noch nicht zufrieden, dehnte sich der ungestüme Eifer des Verfassers auf den Vergleich der Erkenntnis der Neunten mit erinnerten Aspekten anderer Kompositionen Beethovens aus, die direkte Relevanz für das Problem besitzen.
Die Schwierigkeiten bei Aufführungen des „Chorsatzes“ der 9. Sinfonie beginnen damit, daß bei Aufführungen von hervorragenden Dirigenten die orchestrale Seite für sich betrachtet mehr oder weniger zufriedenstellend den wirklichen Beethoven wiedergibt. Selbst mit gut ausgebildeten Stimmen ist dies bei den Gesangspartien nicht der Fall. Um das Problem anhand der schlimmsten Fälle klarzumachen: man bekommt den Eindruck, daß Solisten und Chor eine Hymne aufführen, während das Orchester von einem unterschiedlichen Erzeugungsprinzip beherrscht ist – und in dieser Hinsicht relativ richtig liegt.
In der Praxis verstärkt sich diese Diskrepanz durch die Weise, wie der Chor die Aufführung vorbereitet. Ein Chorleiter und ein Pianist proben mit dem Chor wochenlang. In bekannten Fällen mangelt es dem Chorleiter, wenn er zu den besseren gehört, nicht an einer gewissen Kompetenz, doch ist seine Methode in typischer Weise daran gekettet, daß er den Satz hauptsächlich vom Standpunkt der angenommenen „Hymne” interpretiert. Wenn Orchester und Gesangsstimmen dann zu Proben und Aufführungen zusammenkommen, stellt dies in dem einen oder anderen Maße einen unglücklichen Kompromiß zwischen zwei widerstreitenden Erzeugungsprinzipien dar, welcher der Aufführung der vereinten Kräfte übergestülpt ist.
Daraus ergibt sich ein altbekanntes Problem der Musikwissenschaft. Den abstoßenden romantischen Plunder, der sich in Programmheften über die innere Bedeutung von Schillers Ode An die Freude findet, beiseite, bleibt die Tatsache, daß Beethoven nach 1812 niemals eine musikalische Konzeption an das Ende einer solchen Sinfonie gestellt hätte, wie sie bei den Standard-Aufführungen betont wird. Nimmt man ferner zur Kenntnis, daß Beethoven diesem Schlußsatz den Vorzug gegenüber einer existierenden, musikalisch ausgezeichneten Alternative gab, so sieht man, daß Beethovens Absicht in keinster Weise Sache eines Impulses war. Sich etwas anderes vorzustellen, beweist nur völlige Unkenntnis von Beethoven.
Offenbar dient der Schlußsatz der Neunten einem machtvollen Zweck und ist verbunden (insbesondere) mit dem Eröffnungssatz. Ja, in der Tat: der letzte Satz der Neunten muß von dem Standpunkt betrachtet werden, wie ihn die Große Fuge (Opus 133 und 134) begründet hat. Zwar ist der Schlußsatz der Neunten nicht die Große Fuge, aber aufgeführt werden sollte er wie eine Große Fuge für Orchester und Gesang!
Der musikliebende Laie könnte von folgendem deskriptiven Standpunkt an den Schlußsatz herangehen. Er ist deskriptiv, doch im Prinzip bringt diese Vereinfachung keine Verzerrung.
Man denke sich den Schlußsatz der Neunten als „eine recht übliche Fassung“ eines Schlußsatzes in Beethovens Spätwerken. Sein Beginn ist faktisch eine Improvisation (wie der Schlußsatz der Hammerklaviersonate Opus 106). Aus dieser Improvisation leitet ein Rezitativ für Baß in das Herz des Satzes über, in dem sich als Schlüssel zum Kern des Satzes die Gesangspassage für das einzelne Wort „Freude” erweist. Der Kern des Satzes wird vom spät-Beethovenschen Prinzip der Doppelfuge beherrscht und mit einer Coda beendet.
Die deskriptive Analyse der Komposition ist kurz beschrieben folgende. Die „Freude“-Passage im Eröffnungs-Rezitativ betrachtet man als von Beethoven entwickeltes Kunstmittel, um über das Bachsche fugale Stretto hinauszugehen. Dieser transformierte Begriff des Stretto, ähnlich der nachträglichen Anfügung der zwei Eröffnungsnoten beim Adagio sostenuto der Hammerklavier-Sonate, wird hinsichtlich seiner Implikationen für Beethovens Denken zu dem die Entwicklung und Entwicklungsziele des Doppelfugen-Prozesses leitenden Erzeugungsprinzip. Die Coda „erfüllt“ den Mittelteil, indem sie die durch den treibenden schöpferischen Entwicklungsprozeß im Mittelteil geleistete wissenschaftliche Entdeckung behauptet.
Dem Verfasser ist diese Methode sehr vertraut. In erster Linie erwarb er sie von Beethoven. Dieselbe Methode, die er bei seiner schöpferischen Arbeit anwendet, tritt bei Beethoven in musikalischer Form, nicht in einer auf die politische Wissenschaft bezogenen literarischen Form auf.

Nun höre man eine gute durchschnittliche Aufführung der ganzen Neunten von diesem Standpunkt und beurteile mit Hilfe dessen, was an der Aufführung gut bzw. schlecht ist.
Man verspürt zwangsläufig den Drang, den Chorleiter (ganz besonders ihn) an den Schultern zu packen und ihn zu schütteln, bis seine Denkhemmung sich lockert.
„Dies, Freund Chorleiter, hat nicht das geringste mit der queren Vorstellung einer Hymne zu tun, die Du voll Respekt vor Beethovens Namen und Autorität durchackern mußtest. Das ist keine Hymne mit Orchesterbegleitung. Deine Gesangsstimmen sind untrennbarer Teil der vielleicht gedrängtest komponierten und bewegtesten Entwicklung vom Kontrapunkt in der Musik überhaupt. Eine saubere Satzmelodie des Librettos ist musikalisch belangvoll, die Worte als solche sind es, relativ gesagt, nicht. Das kann einfach nicht wie ein ,vertonter Schiller‘ aufgeführt werden!“
Man könnte fortfahren und zur Beilegung der Sache den Dirigenten herbeiziehen:
„Um Beethovens Willen verlange ich die Spannung seines Kontrapunktes. Ich verlange Überraschung und die Ironien des Kontrapunktes. Betrachtet die Gesangsstimmen als Instrumente wie die Stimmen des Orchesters und entwickelt die Spannung, den Vortrag und die Intonation im Kontrapunkt soweit, bis der letzte Tropfen romantischer Sentimentalität aus der Aufführung getilgt ist. Sänger und Instrumente sind kein ehrfurchtsvoller Chor griechischer Mönche vor Apollos Schrein, noch frönen sie einem dionysischen Gelage. Das ist prometheische Musik, in der sich ständig neue Entdeckung auf Entdeckung häuft und ständig das Verständnis des bereits gehörten sich verwandelt.”
Nur ein einziges Wort des Librettos besitzt beherrschenden musikalischen Wert. Dieses Wort ist „Freude” und bedeutet, wie Beethoven durch die Musik beweist, „Freiheit“. Betrachten wir den musikalischen Wert, den Beethoven diesem herausragenden Wort im Eröffnungs-Rezitativ beigibt, und sehen wir, welche Bedeutung er im Laufe der Entwicklung an diesen musikalischen Keim knüpft.
„Dann werden Sie entdecken, verehrter Chorleiter und Dirigent, daß dieser Satz wirklich vom reifen Beethoven komponiert wurde. Er ist ein typischer Beethoven-Scherz – Freude und Freiheit –, dem er musikalischen Wert verleiht und dieses Konzept zum Erzeugungsprinzip für ein kohärentes Werk nimmt. Ihr aber habt die Aufgabe, diesen Ausformungsprozeß darzustellen und das Erzeugungsprinzip hervorragen zu lassen“.
Der Schlußsatz der 9. Sinfonie ist als eine wirkliche Beethovensche Komposition wiederhergestellt.
Beethoven und Riemann
Genau darum braucht die Menschheit Beethovens Musik. Er gibt dem Ausdruck und verherrlicht das, was den Menschen von Grund auf von der Tierwelt, von feudalen Leibeigenen und wahnwitzigen Fabianern unterscheidet. Er verherrlicht vor allem die einzig und allein menschliche Geisteskraft, ganz neue wissentliche Erkenntnisgebäude zu schaffen. Er feiert und gibt Ausdruck der Tatsache, daß diese Macht selbst von einem gesetzmäßigen Ordnungsprinzip, einem kompromißlos strengen Gesetzesprinzip beherrscht wird. Er feiert und bringt die Tatsache zum Ausdruck, daß das Kausalitätsprinzip in Erkenntnis und menschlicher Praxis nicht in Form eines vorbestimmten, unveränderlichen Universums (selbst nicht eines Bachschen) mit apriori-Bestimmungen für Raum und Zeit existiert, sondern vielmehr gemäß einem universellen Kausalitätsprinzip, das die gesetzmäßig geordnete Herausbildung einer völlig neuen, sich gesetzmäßig ordnenden Geometrie aus ihrem Vorgänger beherrscht. Er beweist, daß die Wahrheit nicht in irgendeiner einzelnen dieser untergeordneten Geometrien, sondern in dem alle diese Übergänge beinhaltenden Gesamtprozeß zu finden ist.

Die Wahrheit in einer solchen Komposition ist nicht, daß sie durch Entwicklung zu einer letzten Lösung gelangt, sondern daß sie in ihrer Lösung auf den Prozeß, der diesen Fortschritt erzielte, zurückblickt. Somit sind sowohl nach musikalischem wie nach erkenntnistheoretischem Prinzip der Schlüssel zur Erzeugungsidee einer (insbesondere) Beethovenschen Spätkomposition jene Phasen, deren Funktion die eines revidierten Stretto ist. Beethovensche Ideen sind nicht in musikalische Form übersetzte Worte – ausgenommen, wenn Beethoven einmal seine musikalische Vorstellung von Begriffen wie Freude und Freiheit zur Erzeugungsidee in musikalischem Sinne nimmt. Beethovens Ideen sind musikalische Ideen, nicht musikalische Interpretationen von Nebensätzen, Sätzen und Schlagworten.
Beethovens Musik ist politisch im tiefsten Sinne. Sie ist die musikalische „politische Literatur“ des prometheischen Humanismus. Wenn man die Interpretation anderen Sichtweisen öffnet, dann führt die Aufführung mit Notwendigkeit zu einer musikalischen Travestie – selbst bei Beethoven-Kompositionen.
Dieser Begriff des Erzeugungsprinzips bei Beethoven ist derselbe wie der Kausalitätsbegriff in einem wahrhaft relativistischen Raum, ein Begriff, wie er heute unentbehrlich geworden ist, um die Beziehung eines normalen physikalischen Raums zur negentropischen Ordnung des physikalischen Raums im Bereich hoher Energiedichte zu verstehen.
Die Kausalbeziehung (d. h. solche linearer Art), wie man sie gewöhnlich aristotelischen Fehlentwicklungen vom physikalischen Raum „im kleinen“, im Bereich kleinster Größenausdehnung, zuschreibt (Lagrange, Maxwell, Einstein und Weyl usw.), bestimmen nicht, und das ist experimentell gesichert, die Ergebnisse, wenn man zu einem höher geordneten physikalischen Raum übergeht. Damit brechen die gewöhnlichen Determinismusvorstellungen im Experiment genau dort zusammen, wo sie nach erkenntnistheoretischen Voraussagen (besonders Riemann und Cantor) selbst für den gewöhnlichen physikalischen Raum zusammenbrechen müssen: im Bereich astronomischer und mikrophysikalischer Erscheinungen. Genau durch Untersuchungen mikrophysikalischer Erscheinungen im Übergang zu einem physikalischen Raum hoher Energiedichte gelangt die Lösung der fundamentalen inneren Widersprüche der alten Physik ins Blickfeld.
In der Physik müssen wir alle aristotelischen und ähnlichen Determinismusvorstellungen als allgemeingültige gesetzmäßige Ordnung der Wirklichkeit fallenlassen. Allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten gibt es weiterhin, und mit größerer empirischer Aktualität als man je zuvor gewußt hat. Gesetzeskraft ist einzig und allein in einem Kausalitätsbegriff zu sehen, der primär die Transformation von einem Raum durch kausale Wirkung in einen anderen beschreibt. Das ist Physik, die Riemann und Cantor theoretisch möglich gemacht haben, und das ist das Geheimnis, das Prinzip von Beethovens Kreativität.
Nun ist es an den Musikern, Beethoven zu studieren und dabei zu lernen, wie man große Musikwerke schafft und aufführt. Dann werden sie diese auch besser aufführen.
